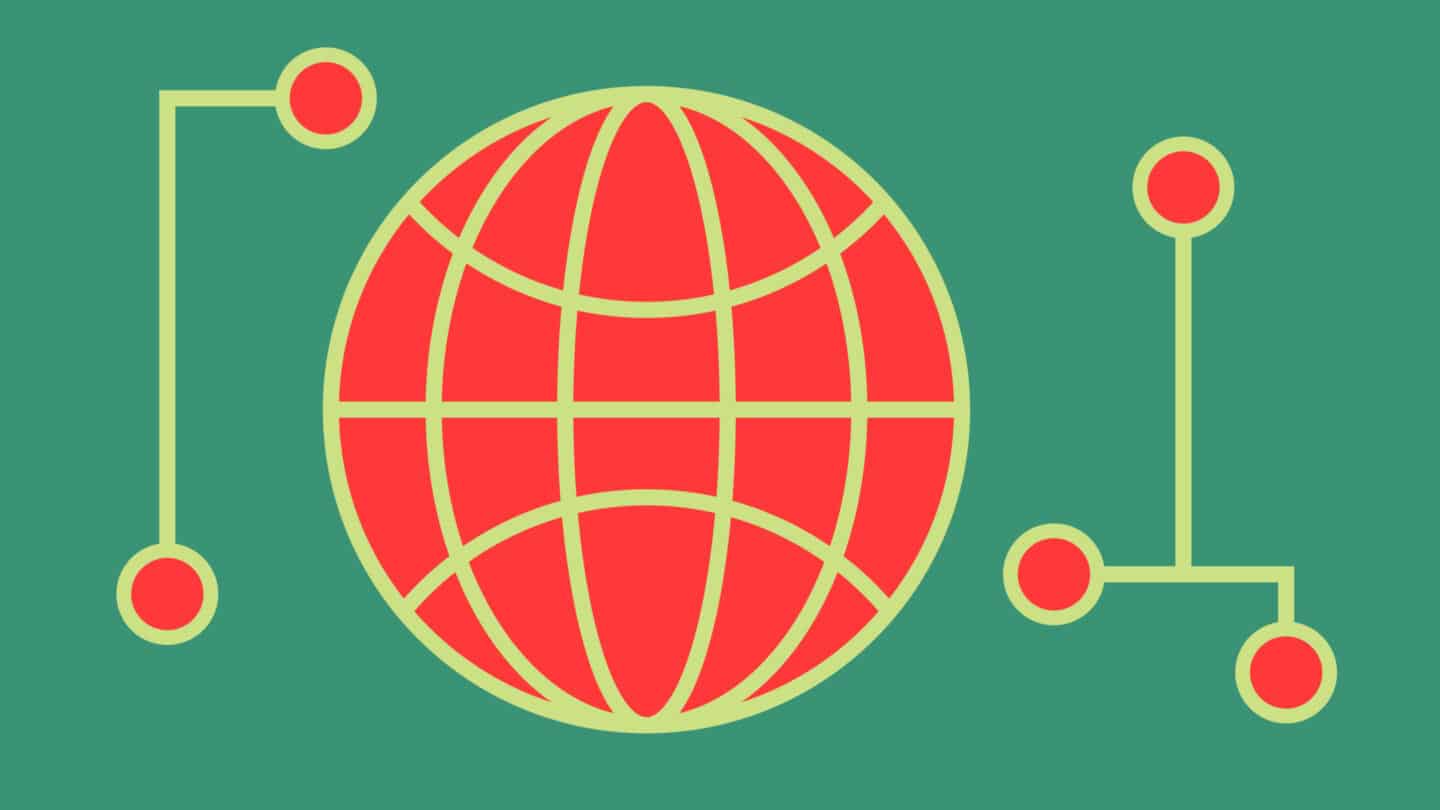
Europäische und internationale Digitalpolitik
Positionen des Bündnisses F5 zur Europawahl 2024
Digital Service Act (Politikbrief)
Für eine gerechte und nachhaltige globale digitale Zukunft
Wir sind überzeugt, dass nur eine am Gemeinwohl orientierte Digitalpolitik eine offene, freie und sichere digitale Zukunft ermöglichen kann. Auf EU-Ebene und in internationalen Organisationen muss daher die Förderung von digitalen Gemeingütern im Mittelpunkt stehen. Solche Gemeingüter sind freie und offene Software, Open Data oder gemeinwohlorientierte Projekte wie Wikipedia. Gesetzen und Richtlinien müssen so beschaffen sein, dass sie die Einhaltung der Menschenrechte sowie die Bedürfnisse von Nutzer*innen, Medienschaffenden und benachteiligten Gruppen im digitalen Raum stärken.
Unsere Vision für eine sichere und offene globale digitale Zukunft:
- Europäische und internationale Institutionen sorgen dafür, dass es selbstverständlich ist, dass mit öffentlichen Mitteln geschaffenes Wissen für alle Menschen frei zugänglich und wiederverwendbar ist.
- Europäische und internationale Akteur*innen stärken Menschenrechte wie Privatsphäre, Meinungs- und Pressefreiheit und verhindern die Schaffung eines digitalen Überwachungsstaates.
- Der öffentliche digitale Diskurs basiert auf echtem Meinungsaustausch und wird nicht von profitorientierten und algorithmisch getriebenen Empörungsspiralen dominiert.
- EU und internationale Organisationen schützen Journalist*innen vor Überwachung, um das Redaktionsgeheimnis und die gesellschaftliche Kontrollfunktion der Medien zu sichern.
- Institutionen und Gesetze stärken Menschen und Gemeinschaften, die eine gerechte digitale Welt aktiv mitgestalten.
- Politikschaffende fördern eine nachhaltige digitale Entwicklungen, die mehr als nur das Nötigste – wie den Zugang zum Internet für alle – sichert.
Positionen des Bündnis F5 zur Europawahl 2024
Im Bündnis F5 haben wir analysiert, welche Maßnahmen die europäischen Gesetzgebenden auf den Weg müssen, um:
- Plattformen im Sinne des Gemeinwohls zu regulieren
- KI gerecht und nachhaltig zu gestalten
- Open Source Software und Open Hardware zu fördern
- Privatsphäre zu stärken und Journalist*innen zu schützen
- Barriere für freies Wissens mit einem Digital Knowledge Act abzubauen
Unsere Forderungen im Überblick
Digital Knowledge Act für freien Wissenszugang
Aktuell können Bibliotheken, Archive, Hochschulen und andere Wissensinstitutionen und Wissen nicht umfassend digital und frei zur Verfügung stellen. Das behindert den Zugang zu Wissen für Bürger*innen, verhindert Forschungskooperationen und hemmt damit Innovationen. Ein europäischer „Digital Knowledge Act“ (DKA) soll verschiedene Regelungen enthalten, die diese Barrieren abbauen. Dazu gehören:
- Informationen aus öffentlichen Institutionen sind vom Schutz des Urheberrechts ausgenommen.
- Ein EU-weites Recht auf elektronische Ausleihe (eLending) ermöglicht es Bibliotheken, digitale Werke unter den gleichen Bedingungen wie gedruckte Werke zu verleihen.
- Ein sekundäres Veröffentlichungsrecht für Forschung stellt sicher, dass Wissenschaftler*innen oder Journalist*innen und alle Bürger*innen öffentlich finanzierte Forschung nicht nur zitieren können, sondern sie auch verlinken und einsehen dürfen.
- Eine einheitliche Ausnahmeregelung für Forschungskooperationen schafft Rechtssicherheit für Wissenschaftler*innen, die geschütztes Material austauschen.
Plattformen regulieren und neu strukturieren
Aktuell dominieren wenige große Tech-Konzerne den Markt für digitale Anwendungen und haben damit quasi Monopolstellungen. Die Funktionsweisen von digitalen Plattformen und Netzwerken haben negative Auswirkungen auf öffentliche Debatten und unsere demokratische Kultur. Um diesen Entwicklungen etwas entgegen zu setzen, müssen bestehende Plattformregulierung, wie der Digital Services Act (DSA) und Digital Markets Act (DMA), wirksam umgesetzt werden.
- Die Behörden auf Bundes- und EU-Ebene, die aktuelle und künftige Regulierung umsetzen, müssen dafür finanziell und personell gut ausgestattet und durchsetzungsfähig sein.
- Die EU sollte bestehende Plattformregulierungen regelmäßig überprüfen und aktualisieren oder sinnvoll ergänzen – etwa durch gesetzliche Verpflichtungen zu größerer Transparenz bei Algorithmen.
Öffentliche Digitale Infrastruktur fördern
Investitionen in eine öffentliche digitale Infrastruktur fördern den Zugang zu Wissen, Software und Daten. Davon profitieren Bürger*innen und Forschende ebenso wie Verwaltungen und Unternehmen. Diese Investitionen fördern also wirtschaftliche Entwicklung ebenso wie gemeinnützige digitale Strukturen. Zu öffentlicher digitaler Infrastruktur gehören freie und offene Software, Open Data, aber auch gemeinnützige digitale Projekte wie Wikipedia, OpenStreetMap oder das Fediverse und Mastodon. Die EU und internationale Organisationen können sie durch verschiedene Maßnahmen stärken.
- Öffentliche Einrichtungen sind verpflichtet mit offener Software zu arbeiten und ihre Informationen als offenen Daten bereitzustellen.
- Europäische sowie internationale Gesetze, Verträge und Programme fördern aktiv offene und gemeinwohlorientierte digitale Projekte und Strukturen.
Gegen Desinformation: Verlässliche Wissenssökosysteme stärken
Im digitalen Raum verbreiten sich Desinformation schnell und machen nicht an nationalen Grenzen halt. Das Beispiel Wikipedia zeigt, welche Mechanismen und Regeln gut gegen Desinformation wirken: Die ehrenamtliche Community hat strikte Regeln dafür festgelegt, wie sie verlässliches Wissen zusammen trägt. Inhalte müssen mit Quellen belegt werden, die verlässlich sind. Inhalte von Wikipedia-Artikeln müssen neutral dargestellt werden und die Sprache sachlich sein. Indem die Ehrenamtlichen Artikel gemeinsam erarbeiten, setzen sie das Prinzip der Peer-Review um.
- Politikschaffende auf europäischer und internationaler Ebene schaffen rechtliche Rahmenbedingungen, die selbstorganisierte Communitys stärken, die verlässliches und quellenbasiertes Wissen bereitstellen.
- Europäische und internationale Gesetzegebende schützen und schaffen Regelungen, die Informationsfreiheit stärken und Zugang zu Wissen ermöglichen.
- Die EU und internationale Organisationen stellen verlässliche Informationen, wissenschaftliche Studien und hochwertige Daten bereit. Sie sind frei lizenziert und somit wiederverwendbar.

Digital Service Act
Politikbrief Frühjahr 2022
Kollaborative, gemeinwohlorientierte Projekte wie die Wikipedia sind ein Grundpfeiler des offenen Internets. Darum müssen solche nichtkommerziellen und von Communitys gepflegten Plattformen auch im Digital Services Act anerkannt und gestärkt werden. Wikimedia Deutschland begleitet den politischen Diskurs aktiv auf EU- und Bundesebene. In diesem Brief zeigen wir auf, was Politik tun kann, um Online-Ehrenamtsprojekte wie die Wikipedia zu stärken.
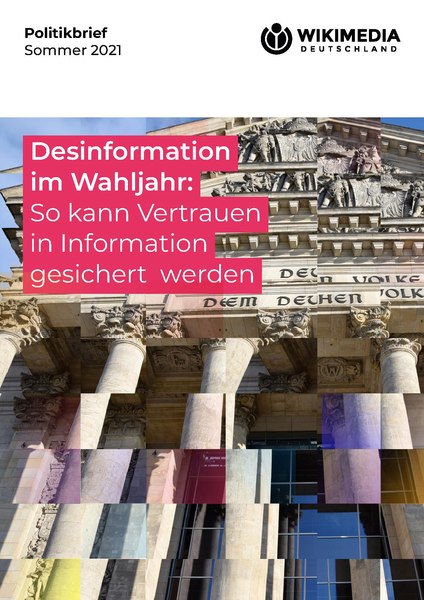
Desinformation im Wahljahr
Politikbrief Sommer 2021
Der Politikbrief erläutert die Wikipedia-Prinzipien, die dafür sorgen, dass die freie Enzyklopädie gut gegen Manipulationsversuche und Desinformationen gewappnet ist. Er nennt vier Maßnahmen, die Politikschaffende umsetzen sollten, um verlässliche und vertrauensvolle Informationen zu stärken.
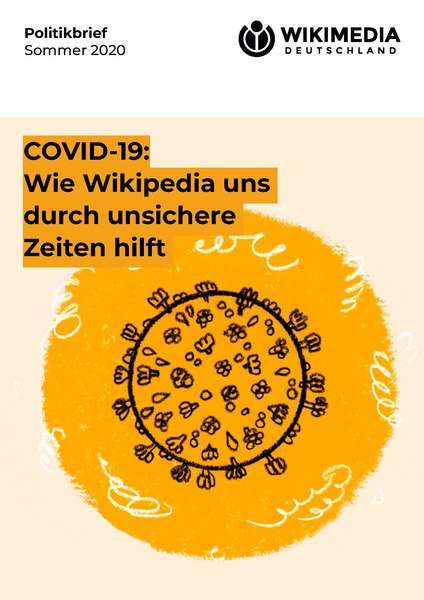
COVID-19
Politikbrief Sommer 2020
Wie ist die Wikipedia während der Covid-19 Pandemie eine verlässliche Quelle für Wissen geblieben? Welche Mechanismen helfen dabei, Desinformationen abzuwehren? Das beschreiben die Autor*innen in diesem Politikbrief.
