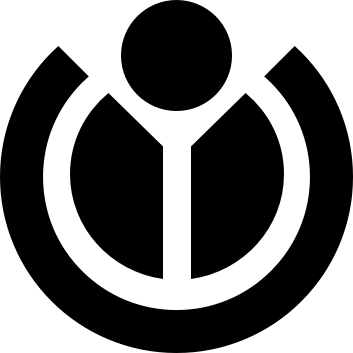Offener Zugang für die Wissenschaft: Wie sieht eine nachhaltige Open-Access-Praxis aus?
Gibt es in der Wissenschaftscommunity noch ein Renommeegefälle zwischen Print- und Open-Access-Publikation?
CHRISTINA RIESENWEBER: Das hat sich mittlerweile geändert. Noch vor fünf Jahren war das Missverständnis verbreitet, es gebe entweder das „gute gedruckte“, oder das weniger qualitätvolle Open-Access-Journal. Das war damals schon ein Irrglaube, der damit zusammenhing, dass die gedruckten Journals häufig alt waren und renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Beiräten hatten – wohingegen viele der Open-Access-Journals einfach Neugründungen waren. Von geringerem Renommee zu sprechen, war also ein Denkfehler. Es gibt heute vergleichsweise junge Open-Access-Journals, die als wichtiger Publikationsort gelten. Es gibt alte, etablierte Open-Access-Journals, die aus Printpublikationen hervorgegangen sind. Und dazu eine Reihe von Zeitschriften, die beides anbieten. Der Konflikt ist heute weniger Print vs. Open Access. Sondern gutes Open Access vs. schlechtes Open Access. Womit die sogenannten Predatory Journals* gemeint sind.
Was macht Open Access attraktiv? Sind Reputation und Sichtbarkeit noch die entscheidenden Währungen – und falls ja: Wie stehen die Kurse?
Die Frage ist ja: Reputation und Sichtbarkeit für wen? Wenn wir als Beispiel einen engen disziplinären Zusammenhang nehmen – etwa Historie der frühen Neuzeit in Westeuropa – existieren vielleicht drei Journals, die wichtig sind, um im eigenen Fach wahrgenommen zu werden. Blicken wir über diesen Kontext hinaus, geht es um Sichtbarkeit in einem weiteren Sinne: Sind die Artikel online gut auffindbar? Finden mich Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anderer Fächer oder aus anderen Sprach- und Kulturräumen? Da ist es nicht mehr wichtig, welcher Titel auf dem Journal steht oder ob es in meiner Community als Starmaker-Journal gehandelt wird. So, wie sich Wissenschaft insgesamt global verändert, hat der Aspekt der Sichtbarkeit den der Reputation überholt.
Welche Rolle spielt Sichtbarkeit?
Eine hohe Sichtbarkeit ermöglicht ja auch die Wahrnehmung von wissenschaftlichen Ergebnissen außerhalb der akademischen Communitys. Das vergangene Jahr hat gezeigt, wie wichtig es war, dass sowohl zum Thema Virologie als auch zum Thema Rassismusforschung weltweit so viele frei verfügbare Forschungen existierten – sodass auch Menschen, die nicht Expertinnen oder Experten sind, sich damit auseinandersetzen können. Wir sind an einem Punkt, an dem Open Access Fake News verhindern kann. Alle haben Zugang zu den Erkenntnissen und müssen sich nicht darauf verlassen, dass Fachleute sie aufbereiten. Hier aber kommt der Faktor Qualität ins Spiel. Damit Laien einschätzen können, ob das, was sie da lesen, hochwertig ist, braucht es leicht verständliche Marker. Worauf man sich nicht verlassen sollte, das ist der sogenannte Journal Impact Factor.
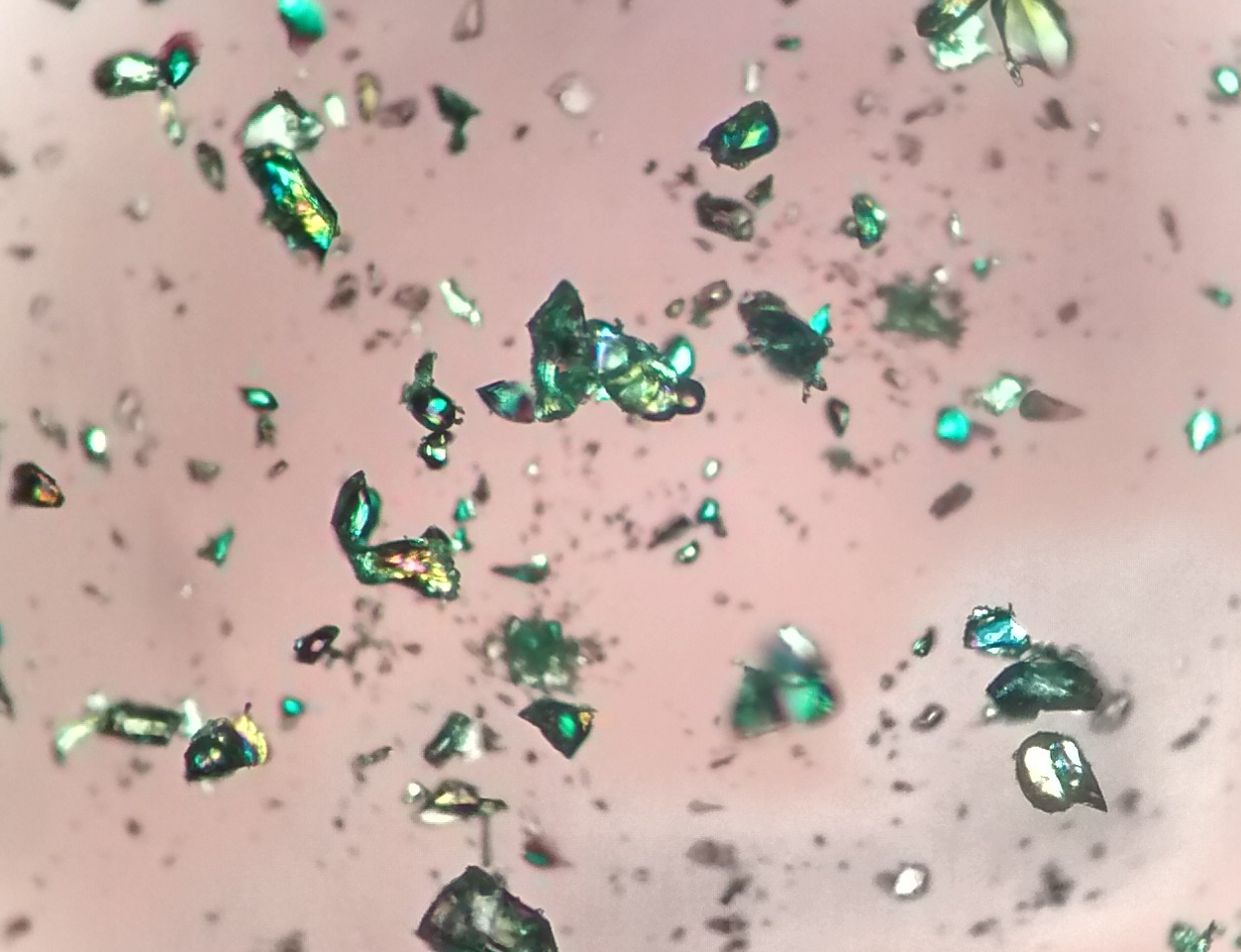
Was verbirgt sich hinter dem Journal Impact Factor?
Der Versuch, quantitativ zu beschreiben, welche Journals besonders gute Wissenschaft enthalten. Aber es ist eine Zahl, die nicht das aussagt, was sie vorgibt. Trotzdem wird sie herangezogen.Der Journal Impact Factor gibt die durchschnittliche Zitationsrate von Zeitschriften an – wie oft wird ein Artikel aus dieser Zeitschrift im Durchschnitt zitiert? Das sagt aber natürlich nichts darüber aus, wie hochwertig der einzelne Artikel ist. Wenn eine Zeitschrift nur Belanglosigkeiten publiziert, aber einen Artikel eines Nobelpreisträgers im Jahr hatte, wird der durchschnittliche Journal Impact Factor natürlich hoch ausfallen. Ein Teil der Open-Access-Community versucht, aktiv neue Qualitätsmerkmale zu etablieren, um vom irreführenden Impact Factor wegzukommen.
Wie sieht der Markt für Open-Access-Journals gegenwärtig aus?
Der Markt hat sich leider zu großen Teilen an den Big Playern ausgerichtet. Es gibt in Deutschland – und auch in anderen Ländern – ein Projekt namens DEAL. Dahinter verbirgt sich bundesweites Konsortium von wissenschaftlichen Bibliotheken, das sich mit den drei größten Wissenschaftsverlagen – Springer Nature, Wiley, Elsevir – zusammengesetzt hat, um mit ihnen Open-Access-Abkommen zu schließen. Das bedeutet, die Wissenschaft hat sich dazu entschieden, die Töpfe zuerst mit den Marktführern zu teilen, die nach wie vor ihre Macht ausnutzen, um die Preise zu diktieren. Am Beginn von Open Access stand die Idee, sich aus der ökonomischen Zange der Wissenschaftsverlage zu lösen. Das ist nicht passiert. Es ist nicht so, dass kleinere und mittlere Open-Access-Verlage der Reihe nach pleitegingen. Aber sie haben nach wie vor Schwierigkeiten, sich dem Markt anzupassen.
Warum gibt es nicht mehr Verlagsgründungen an Universitäten?
Der erste Grund führt zurück zum Stichwort Reputation. Das Reputationssystem funktioniert über Tradition. Das Bekannte pflanzt sich fort. So funktioniert im Grunde das gesamte Wissenschaftssystem. Der zweite Grund: weil Wissenschaft international ist. Wenn alle deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an ihren lokalen Unis in ihren lokalen Zeitschriften publizieren würden, würde es die internationale Sichtbarkeit wieder einschränken. Deswegen bietet es einen Vorteil, wenn man mit den internationalen Big Playern arbeitet. Das Perverse ist, dass die großen Verlage mittlerweile ihre Geschäftsmodelle verändert haben und auf Open Access gar nicht mehr angewiesen sind. Auch hier gilt der Satz: „Daten sind das neue Öl.“ Geld wird mit der Verwaltung von Forschungsdaten, auch mit Forschungsinformationssystemen verdient – Systeme, die Forschung vergleichbar und messbar machen: Wie gut ist meine Uni? Wie gut sind meine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler?
Gibt es alternative ökonomische Modelle?
Es gibt zum Beispiel den Versuch, neue Netzwerke zu schaffen. Es existiert ein neues deutsches Open-Access-Netzwerk, es gibt Uni-Verlage, die ihr Portfolio ausbauen oder überlegen, wie sie mehr Angebote schaffen können, die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstützt die Transformation einzelner Zeitschriften in Open Access. Aber an der festen Position der großen Verlage wird damit nicht gerüttelt, trotz mancher Imageverluste. Aber wenn jemand die Wahl hat, in einer renommierten Elsevir-Zeitschrift zu publizieren, macht sie oder er das natürlich trotzdem.
Weil Kapitalismuskritik und Karriereplan auf zwei verschiedenen Ebenen stattfinden.
Wie ließe sich mehr Nachhaltigkeit für Open Access schaffen?
Die Frage hängt eindeutig mit den Fördervolumina und Förderzyklen der großen Geldgeber zusammen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert seit Jahren Innovationsprojekte im Bereich Open Access – was dazu führt, dass eine Handvoll Projekte Geld bekommen, besonders, wenn sie mit Start-ups zusammenarbeiten und cool aussehen. Aber eigentlich bräuchten wir langfristige Infrastruktur-Unterstützung durch die Fördergeber. Und gezieltere Förderung von Wissenschaftsverlagen und Publikationsorten, die nicht bereits einer der Marktführer in Monopolfunktion sind.
*Spotlight: Predatory Journals
Um Open Access zu ermöglichen, muss Geld fließen. Die Dienstleistungen, um eine Zeitschrift herauszubringen, müssen auch dann bezahlt werden, wenn sie für die Leserinnen und Leser kostenfrei ist. Diese Kosten werden an anderer Stelle gedeckt. Ein Modell, das sich mittlerweile durchgesetzt hat, ist das der „Article Processing Charges“ – die Autorin, der Autor, ihre Institution oder ein Konsortium bezahlt den Verlag dafür, den Artikel so zu veröffentlichen, dass er am Ende kostenfrei ist. Als dieses Modell auf den Markt kam, haben einige unlautere Verlage oder Zeitschriften versucht, daraus Kapital zu schlagen. Sie haben minderwertige Publikationen erstellt, um „Article Processing Charges“ zu kassieren. Entsprechend wurden sie Predatory Journals genannt, also „Raubzeitschriften“. Diese Predatory Journals bieten keine verlässlichen Qualitätssicherungsprozesse, kein vernünftiges Peer Review, kein gutes Marketing. Die Texte werden zwar tatsächlich publiziert. Aber es sind Journals ohne Renommee und Reichweite.