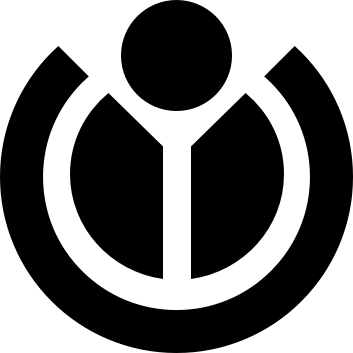„Wir müssen die Menschen wertschätzen, die ihre Zeit spenden“ – Wie Kulturerbe-Institutionen sich öffnen
Ein Interview mit Larissa Borck
Immer mehr Kulturerbe-Institutionen öffnen sich mittlerweile digital. Wo fehlt es noch an Zugängen?
LARISSA BORCK: Kulturelles Erbe findet in sehr vielen Institutionen in sehr vielfältigen Zusammenhängen statt. Kulturerbe kann auch der Döner sein, der uns eine Geschichte über die Entwicklung von Deutschland als Einwanderungsgesellschaft erzählt. Wie vermittelt man so ein Kulturgut digital, wie wird es online zugänglich? Das ist eine andere Frage als die nach der digitalen Öffnung von physischen Museumssammlungen oder Bibliotheksbeständen.
Digitale Präsenz ist aber nicht gleich Zugang: Vom kleinsten Museum bis zur größten Bibliothek ist es mittlerweile Common Sense, dass man eine Webseite und einen Account in den sozialen Netzwerken braucht. Zugang, das wirft aber auch die Frage auf: Wer hat den Schlüssel zu unseren Angeboten? Können wir sicher sein, dass die Menschen entsprechende digitale Kompetenzen besitzen? Das ist in vielen Ländern gegeben, gilt aber nicht für die gesamte Welt. Auch wenn eine Webseite nicht barrierefrei ist, schließt sie bestimmte Zielgruppen aus. Und dann müssen wir den nächsten Schritt nehmen: Wie viel unserer imaginierten Kontrolle und Deutungshoheit geben wir ab? Dürfen sich die Menschen die Sammlungen nur digital anschauen, oder dürfen sie die Digitalisate selbst nutzen? Zugang zu Kulturerbe-Sammlungen ist daher immer auch im Kontext einer umfassenden Veränderung des gesellschaftlichen Verständnisses von Kulturerbe zu verstehen.
Gibt es gute Beispiele für offene Daten und offene Sammlungen als Motor von Innovation?
Innovation ist kontextabhängig. Gerade im Digitalen geht es leider zu oft um den nächsten Hype.
Vor fünf Jahren hätten manche es vielleicht für innovativ gehalten, dass Museen darüber diskutieren, ob sie eine Blockchain für ihre Ticketsysteme brauchen. Nein, brauchen sie nicht! Wenn Sie sich Plakate von Veranstaltungen über digitale Transformation oder Innovation anschauen: Da wird häufig mit der Bildsprache der VR-Brille gearbeitet. Ist diese Technik innovativ, wenn wir über gesellschaftlichen Zugang zu Kulturgut sprechen?
Ich finde, man ist dann innovativ mit seinen Inhalten, den offenen Daten, seiner Institution oder dem Kulturerbe, das man für die Allgemeinheit bewahrt, wenn man damit Relevanz in seiner Community erreicht hat. Im Bereich offene Daten können diese Community zum Beispiel die Wikipedia-Autor*innen sein – offene Daten können aber auch die Stadtgesellschaft in ihrem Alltag bereichern und urbane Räume transformieren, wie das Statens Museum for Kunst in Kopenhagen gezeigt hat. Das Digitale kann viele Communitys erreichen, und Innovation kann je nach Zielgruppe sehr unterschiedlich aussehen.
Wie lässt sich Analoges und Digitales zusammen denken?
Bei Open Data geht es um Offenheit als Wert. Und davon leiten die Institutionen ihre Maßnahmen und Strategien ab, auf einem Spektrum von analog bis digital. Das sind ja keine Gegensätze oder getrennte Sphären. Ein gutes Beispiel dafür ist das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg, das im digitalen Bereich eine sehr weitreichende Open-Access-Policy hat, seine Daten in verschiedenste Plattformen einspeist, also dorthin geht, wo die User*Innen sind – statt davon auszugehen, dass die Menschen schon dorthin kommen, wo das Museum ist, auch im digitalen Raum. Im Physischen wurde zudem ein Raum geschaffen, der sich „Freiraum“ nennt. Ein Teil des Gebäudes, in dem früher auch Ausstellungen stattfanden, hat sich der Stadtgesellschaft geöffnet, ohne Eintritt. Man kann dort arbeiten und sich austauschen. Solche Orte sind in der Großstadt ein rarer werdendes Gut.

Lizenzhinweis

Wie können sich die Institutionen diverseren Communitys öffnen? Muss Diversität bei den eigenen Mitarbeitenden beginnen?
Auf jeden Fall. Das ist eine der zentralen Herausforderungen und Verpflichtungen für Kulturerbe-Institutionen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten – die Mitarbeiterschaft zu diversifizieren. Aber das hat nicht nur etwas damit zu tun, wen man ansprechen möchte. Sondern auch damit, wie man das Kulturgut betrachtet, das man für die Allgemeinheit vermittelt und bewahrt. Ein Objekt ist ja nichts Neutrales. Der Blick, den wir auf Kulturerbe werfen, ist von unserer eigenen Positionierung und Erfahrung in der Gesellschaft abhängig. Von daher brauchen wir Diversität, um andere Perspektiven auf unser Kulturerbe, unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu entwickeln. Ein Denkfehler in der Debatte um Diversität ist ja oft die Erwartung: Frauen sollen Feminismus erklären, People of Colour sich zu Rassismus äußern. Aber die Verantwortung, aus einseitigen Denkmustern auszubrechen, liegt doch bei jeder und jedem einzelnen.
Wie können Freiwilligen-Communitys besser mit Kulturerbe-Institutionen zusammenarbeiten?
Die Ziele und Anliegen überschneiden sich oft, aber die jeweiligen Arbeitsweisen und Hintergründe sind sehr verschieden. Es gibt ja auch viele Ehrenamtliche, die kleine Museen betreiben, gerade in ländlichen Regionen. Auch das sind Freiwilligen-Communitys. Ich sehe die Kulturerbe-Institutionen vor allem in der Verantwortung, nicht nur dann mit Freiwilligen zu arbeiten, wenn es dem eigenen Vorteil dient. Jede Einrichtung muss einen Weg finden, die Menschen, die freiwillig ihre Zeit für etwas spenden, auch entsprechend zu wertschätzen. Ein Beispiel ist das Rijksmuseum in Amsterdam, das jedes Jahr einen Preis – den Rijks Studio Awards – an Menschen verleiht, die mit ihren Daten kreativ Neues schaffen. Oder das Nordische Museum in Stockholm, das mit Schulen kooperiert, um Wikipedia-Artikel zu verbessern. Die Schülerinnen und Schüler schreiben ihre Abschlussarbeiten im Museum, bekommen dort Unterstützung, lernen gleichzeitig auch, die Wikipedia zu bearbeiten und mit dem erworbenen Wissen zu verbessern. In gewisser Weise ist auch das eine Freiwilligen-Arbeit.
Wie können die Institutionen untereinander besser vernetzt arbeiten?
Wir brauchen eine offene und transparente Fehlerkultur. Viele Institutionen wollen Datensätze und Onlinesammlungen erst dann publizieren, wenn sie ein vermeintlich hochqualitatives Level erreicht haben. Aber das ist im Kulturerbe-Bereich kaum zu erreichen, aufgrund der Masse an Daten und der sich verändernden Anforderungen im digitalen Bereich. Im Englischen gibt es den schönen Begriff failing forward: durch Fehler lernen und sich weiterentwickeln – gemeinsam. Und grundsätzlich sind gute Dokumentationen und offene Lizenzen vonnöten. Das Science Museum in London hat zum Beispiel ein Tool auf der Basis seiner digitalen Sammlung entwickelt, das einem zufällig Objekte vorschlägt, die noch nie ein anderer Mensch angeklickt hat. Der Code ist bei GitHub offen zur Verfügung gestellt, andere Museen können ihn nutzen – und User*innen können helfen, ihn von Fehlern zu befreien.
Gibt es noch eine Open-Culture-Bewegung?
Ich selbst bin in diesen Sektor gekommen, weil ich Menschen kennengelernt habe, die mit voller Überzeugung dafür kämpfen, dass Kulturgut offen und digital zur Verfügung gestellt wird. Und diese Menschen gibt es nach wie vor auf der ganzen Welt. Gerade das Jahr 2020 hat vielen gezeigt, wie notwendig diese Arbeit ist. Es gibt den „Open GLAM Survey“ – da werden auf der ganzen Welt Institutionen verzeichnet, die ihre Sammlung mit offenen Lizenzen ins Netz stellen. Im vergangenen Jahr haben Douglas McCarthy und Andrea Wallace, die Autor*innen, die hinter dem Survey stehen, zusammen mit anderen einen koordinierten Anlauf unternommen, um noch mehr Institutionen aus der ganzen Welt einzubringen. Auch, weil es noch immer eine Dominanz von europäischen und US-amerikanischen Institutionen in Sachen Sichtbarkeit gibt. Alle, die mit Kulturerbe arbeiten, sollten es sich zur Aufgabe machen, den Gedanken der Offenheit florieren zu lassen. Und gleichzeitig diejenigen unterstützen, die nicht über die gleichen Ressourcen verfügen.