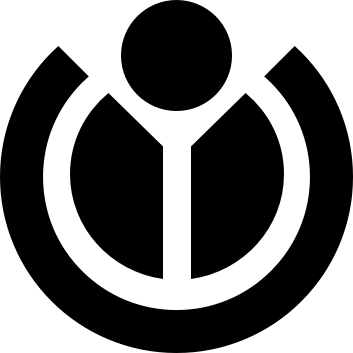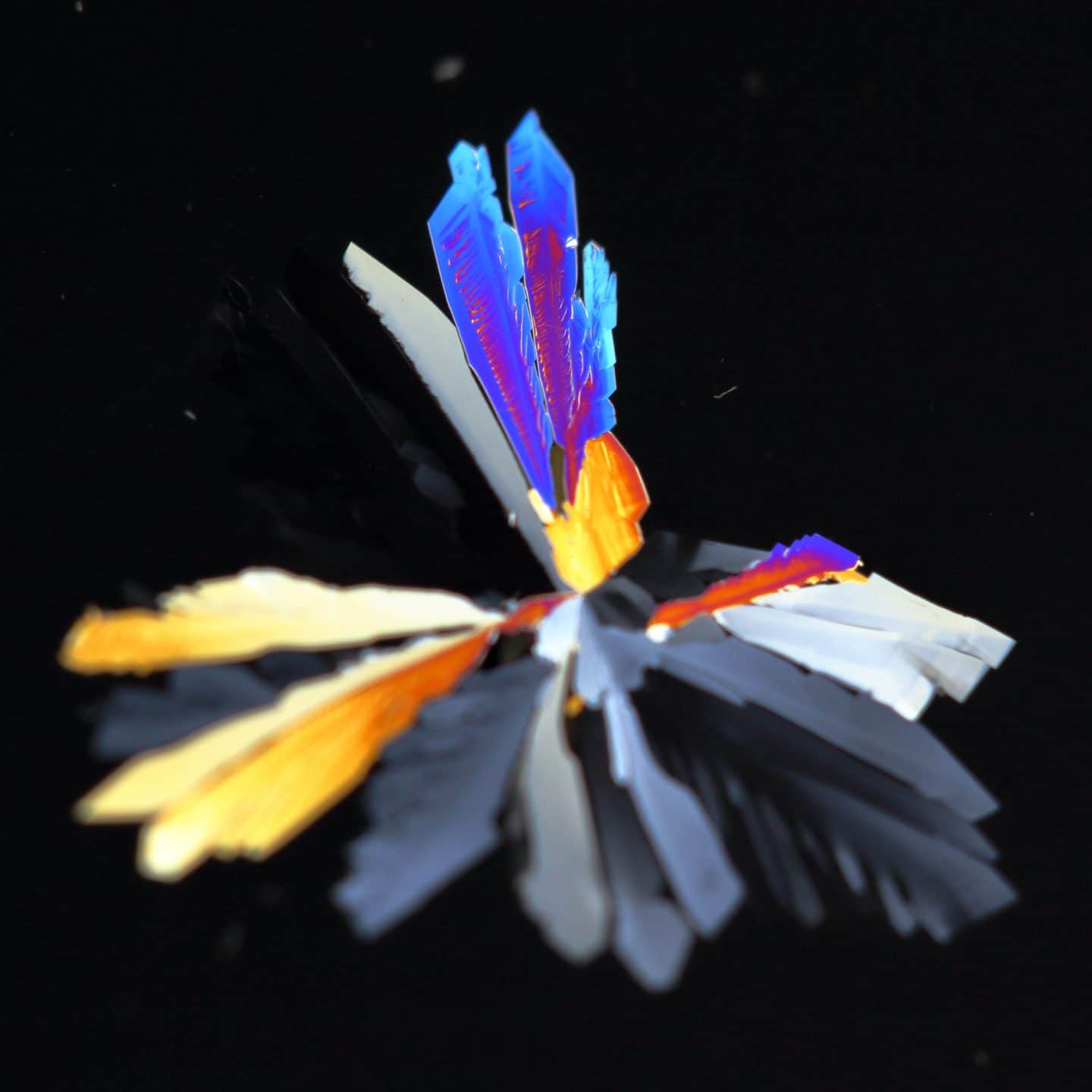Ein Interview mit Bijan Moini
Brauchen wir mehr Datenbewusstsein, um über Datenpolitik sprechen zu können?
BIJAN MOINI: Die wenigsten Menschen begreifen, welchen Wert Daten besitzen. Und das meine ich nicht nur im ökonomischen Sinne, sondern auch im ideellen: Private Fotos, Informationen über Vorlieben aller Art – solche personenbezogenen Daten sind nicht mit einem Eurobetrag zu versehen, aber für den Einzelnen im Zweifelsfall extrem wertvoll. Dazu kommt eine zweite ideelle Ebene, nämlich die gesamtgesellschaftliche: Wie werden Daten zu Überwachungszwecken eingesetzt, wie versuchen Konzerne, mit Daten politische Diskurse in eine bestimmte Richtung zu lenken? Für diese Fragen brauchen wir einen regulativen Rahmen. Die Kenntnis der Macht, die in Daten steckt, kann nur der erste Schritt sein.
Immerhin gab es in Deutschland ein Jahr lang eine Datenethik-Kommission. Was hat sie bewirkt?
Die Kommission hat viele Facetten auf den Plan gebracht, die in der komplexen Gemengelage oft unberücksichtigt bleiben. Unter anderem hat sie den Blick darauf gelenkt, dass auch der Staat über Daten verfügt, die für die Zivilgesellschaft wertvoll sind und für Gemeinwohlzwecke eingesetzt werden könnten. Bei der „Gesellschaft für Freiheitsrechte“ unterstützen wir zum Beispiel einen Kläger, der vom Deutschen Wetterdienst den Algorithmus bekommen möchte, mit dem Bienenflüge vorhergesagt werden. Der Mann – ein Informatiker, der eine Bienenallergie hat – will den Quellcode für eigene Zwecke nutzen und ihn auch öffentlich machen. Die Behörde weigert sich aber, den Algorithmus herauszugeben. Für uns völlig unverständlich.

Lizenzhinweis

Welche Daten des Staates sollten noch offen liegen?
Generell haben wir in Deutschland eine Kultur der Geheimhaltung. In angelsächsischen Ländern ist es schon länger Tradition, dass der Staat die Daten offenlegen muss, über die er verfügt – bisweilen auch unter Missachtung persönlicher Datenschutzinteressen. Bei uns ist erst in den 2000er-Jahren das Informationsfreiheitsgesetz eingeführt worden, das aber nicht den Charakter eines Grundrechts hat. Organisationen wie „Frag den Staat“ oder Journalistinnen und Journalisten müssen Hunderte von Verfahren anstrengen, um auf Archivmaterial oder aktuelle Informationen zugreifen zu können. Daran zeigt sich schon, dass der Staat noch immer der Überzeugung ist, er arbeite am besten hinter verschlossenen Türen. Es existieren ja auch keine Schnittstellen oder Datenbanken, wo man einsehen könnte, was überhaupt verfügbar wäre – ob Verkehrsdaten, Umweltdaten oder Unternehmensdaten.
Wie steht es umgekehrt um unsere eigenen Daten? Sehen Sie Defizite bei der Datenschutzgrundverordnung?
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) regelt ja vor allem die Verarbeitung von Daten durch Private. Daneben gibt es die klassischen Datenschutzgrundrechte, die uns zum Beispiel vor Überwachung durch den Staat schützen sollen. In beiden Fällen gibt es Probleme. Die DSGVO enthält auch schwammige Begriffe, sie lässt Interessenabwägung zu. Wenn ein Unternehmen auf Daten zugreifen will, um ein Produkt zu verbessern, kann es dieses den Schutzinteressen der Nutzerinnen und Nutzer entgegenhalten. Da kommt es sehr auf die Auslegung an. Ich stoße immer wieder auf Fälle, die mit der DSGVO nicht in Einklang zu bringen sind.
Zum Beispiel?
In Polen hat ein kleines Unternehmen den Service angeboten, dort Fotos hochzuladen – woraufhin dann das gesamte Internet nach Bildern dieser Person durchsucht und ein bestimmtes Profil von ihr erstellt wurde. Der Horrorfall solcher Anwendungen würde eintreten, wenn in einigen Jahren Datenbrillen verbreitet wären, mit denen sich beliebige Menschen auf der Straße scannen lassen – wer sie sind, woher sie stammen, mit wem sie sich treffen. Die entsprechende Gesichtserkennungssoftware existiert längst. Nur aus ethischen Gründen nutzen Google und Facebook sie vorerst nicht.
Zumindest ist es mit der DSGVO nicht möglich, globale Konzerne einzuschränken …
In den USA hat eine Gruppe von 46 Bundesstaaten Klage gegen Facebook angestrengt, mit dem Ziel, WhatsApp und Instagram wieder aus dem Konzern herauszulösen und die Praxis des Konkurrentenaufkaufs zu unterbinden. Niemand wird behaupten, dass das mit unserer DSGVO zusammenhinge. Aber die Tatsache, dass es in Europa eine so umfangreiche Debatte über die Macht von Datenkonzernen gab, ist durchaus in den USA wahrgenommen worden und hat zumindest auf Ebene der Bundesstaaten zu neuen Gesetzen geführt. Wir können in Deutschland nicht Facebook regulieren. Aber wir haben Einfluss auf die EU, und die EU wiederum besitzt Einfluss in der Welt. Der Umgang mit Daten ist ein globales Thema, genauso wie der Umweltschutz.
Sollte Europa mehr digitale Souveränität anstreben?
Wünschenswert wäre es. Die Frage ist nur: Wie erreichen wir sie? Viele fragen sich, weshalb es kein europäisches Facebook gibt, kein europäisches Google? Wir hatten ja StudiVZ. Aber es existieren eben doch strukturelle Unterschiede zwischen den USA und Europa, die verhindert haben, dass sich solche Varianten bei uns durchsetzen. Wir haben eine Vielzahl verschiedener Sprachen, auch eine andere Haltung zu Risikokapital. Das ist nicht nur ein Problem unserer Datenschutzregulierung.
Was bräuchte es, um eine Datenstrategie nachhaltig zu gestalten?
Jedenfalls mehr als eine Datenethikkommission, die sich nach einem Jahr wieder auflösen muss.
Nachhaltigkeit bedeutet zunächst mal, offen für Veränderungen zu sein. Es ist in der heutigen Zeit in keinem Politikfeld eine gute Idee, irgendetwas für die nächsten 20 Jahre festschreiben zu wollen. Ohnehin hinken wir ja den vielen Möglichkeiten, die Konzerne ausschöpfen, unentwegt hinterher. Wenn man fünf Jahre after the fact ein Dokument aufsetzt, das dann drei Jahre später Gesetz wird, ist man fast eine digitale Generation zu spät dran. Wir brauchen Mechanismen und Strukturen, die darauf ausgelegt sind, sich ständig zu ändern – und Institutionen, die sich das leisten können.