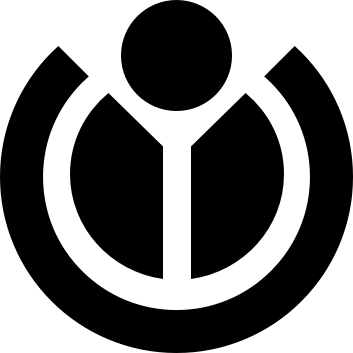Wem gehört die Kunst?
Ein Interview mit Nora Al-Badri
Viele Kulturerbe-Institutionen beginnen sich verstärkt zu fragen, welche Perspektiven sie erzählen, welche Sichtweisen sie ausblenden und was Dekolonisierung von Kulturgut für sie bedeuten würde. Erleben wir einen Mindshift?
Es gibt auf jeden Fall ein ausgeprägteres Bewusstsein in der Gesellschaft und dadurch auch mehr Druck auf die Institutionen. Aber strukturelle Änderungen, die echten Wandel herbeiführen könnten – zum Beispiel die Bereitschaft, Fragen von Besitz neu zu denken – sehe ich in Deutschland und auch in Europa kaum. Es gab in Frankreich durch den von Emmanuel Macron in Auftrag gegebenen Restitutions-Report einen Impuls, in dessen Folge auch einige Objekte an die Herkunftsländer zurückgegeben wurden. Aber was wir nicht gesehen haben, weder im Louvre noch in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ist ein Umdenken in größerem Stil. Im Gegenteil. Vielfach wird die Öffnung von Datenbanken aktiv verhindert. Das ist nicht mehr zeitgemäß und nicht mehr legitim.
„Digitalobjekte besitzen eine große Wirkmacht und können Diskurse in Gang setzen – die Reproduktion ist kein Sklave des Originals.“
Nora Al-Badri
Welche Rolle spielt Digitalisierung in diesem Prozess des Umdenkens? Und welche sollte sie spielen?
Inzwischen leben wir im postdigitalen Zeitalter, das heißt, es stellt sich ohnehin die Frage, inwiefern das Originalobjekt noch gebraucht wird. Nicht jeder Mensch kann jedes Museum auf der Welt besuchen. Natürlich ist es eine tolle User Experience, spontan eine digitale Sammlung in Peru zu besuchen und sich die Objekte nebst Objektbiografien anschauen zu können. Aber auch in meiner künstlerischen Praxis schaue ich vor allem auf das emanzipatorische Potenzial von Digitalisierung.
Worin liegt dieses Potenzial?
Damit meine ich, dass Künstlerinnen und Künstler, aber auch Menschen aus den Herkunftsländern der Objekte, sich die Objekte und ihre Geschichten digital aneignen und damit umgehen können. Fakt ist auch, dass von großen Sammlungen teilweise nur ein Bruchteil ausgestellt wird. Entsprechendes Potenzial hat Digitalisierung als Archiv und Sichtbarmachung von Sammlungen – nicht zuletzt, wenn es um die Frage von Raubkunst und Restitution geht. Man kann nichts zurückverlangen, von dessen Aufenthaltsort man nichts weiß. Digitalobjekte besitzen eine große Wirkmacht und können Diskurse in Gang setzen – die Reproduktion, die digitale Kopie ist kein Sklave des Originals. Das hat auch mein Projekt „The Other Nefertiti“* gezeigt. Die Kehrseite ist, dass viele Museen daraus ableiten, Digitalisierung mache die Restitution überflüssig. Ein Trugschluss.

Auf welche Weise sollten Institutionen ihre Datensätze veröffentlichen?
Es gibt eine Praxis von Museen, Datensätze nur zum Anschauen freizugeben, aber nicht zum Herunterladen und Remixen. Das reicht eben nicht. Auch das ist ein Versuch der Institutionen, die Kontrolle zu behalten, was in diesem Kontext überhaupt nicht angebracht ist. Weil die Ursprungsfrage – wem gehört das Originalobjekt? – bei Weitem noch nicht geklärt ist. Ein weiterer wichtiger Punkt: Wenn es um die Digitalisierung von ethnografischen oder archäologischen Objekten geht, muss man in die Herkunftsländer schauen. Es gibt zum Beispiel einige indigene Protokolle, die den Digitalisaten von heiligen oder spirituellen Objekten die gleiche Kraft zusprechen wie dem Original. Auch da stellt sich die Frage: Wer entscheidet, was gescannt und was veröffentlicht wird?
Sie sprechen im Kontext Ihrer Arbeit von „Techno Heritage“ – was ist damit gemeint?
Das ist ein künstlerisches Konzept. Häufig, wenn wir über Sammlungen und Kulturerbe reden, bleibt der Blick in die Vergangenheit gerichtet. Was ich für relevanter halte: Wie die Vergangenheit mit der Gegenwart und vielleicht weniger kolonialen Zukünften verknüpft ist. Dadurch, dass ich Objekte zu Techno Heritage erkläre, versuche ich, diese Fragen aufzuwerfen.
„Es doch schon, wenn ein einzelner Mensch aus dem Amazonasgebiet ein digitalisiertes Objekt aus seiner Region in einer Sammlung des Globalen Nordens entdeckt, es beforschen und vielleicht Ansprüche stellen kann.“
Nora Al-Badri
Mit Ihrem Projekt „Fossile Futures“ haben Sie die Digitalisierung des Brachiosauraus-Skeletts im Berliner Museum für Naturkunde betrieben. Welche Fragestellung an Kulturerbe stand dahinter?
Dieser Brachiosaurus ist auf seine Art auch ein Fall von Raubkunst, nur dass es sich eben um ein fossiles Artefakt handelt. In Tansania werden die Saurierknochen als eben solche heiligen Objekte angesehen. Die Herkunfts-Communitys sind nicht glücklich damit, dass heute 230 Tonnen Knochen in Deutschland verweilen und hier ausgestellt werden. Tendaguru – der Hügel, wo die Funde gemacht wurden – war für sie ein spiritueller Ort, der dadurch seinen Wert verloren hat. Ein anderes Werk von mir heißt „Babylonian Vision“, dabei geht es um Objekte aus Mesopotamien, insbesondere des heutigen Irak, die in den größten Sammlungen des globalen Nordens zu finden sind. Ich habe die Webseiten der entsprechenden Museen gescraped, also automatisch alles heruntergeladen. Das Projekt legt den Fokus auf digitale Technologien, speziell auf Künstliche Intelligenz (KI).
Wo ist der Link zwischen Kunst und KI?
Es gibt KI, die zum Beispiel mit Millionen Porträts noch lebender Menschen trainiert werden, teilweise auch im akademischen Kontext, was dann aber Firmen wie Google nutzen. Die KI lernt, wie sich ein Gesicht zusammensetzt, und kann die Bilder nicht nur remixen, sondern komplett neue Gesichter schaffen. Das könnte in Zukunft beispielsweise für Deep Fake eingesetzt werden – Videos, in denen etwa Politikerinnen und Politikern Sätze in den Mund gelegt werden. Die Technologie heißt „General Adversarial Networks“, eine neue Form von Bildgenerierung. Dieses Prinzip habe ich auf die babylonischen Objekte übertragen, um darauf hinzuweisen, was möglich ist. Man braucht eine kritische Masse an Input – und dadurch lernt das Programm, was das Wesen der Bilder ist. Auf dieser Basis kann es sie nicht nur reproduzieren, sondern tatsächlich neue Formen schaffen.
Im Kulturerbe-Bereich wächst das Infragestellung von Besitzansprüchen an und Deutungshoheit über Kunst. Was können speziell Open Data und Citizen Science dazu beitragen?
Natürlich sind Potenziale vorhanden, wenn Menschen gestalten und remixen können, das sollte aber nicht überschätzt werden. Denn ansonsten landet man schnell bei einer Quantifizierung von Downloads, Cultural Big Data sozusagen. Dabei genügt es doch schon, wenn zum Beispiel ein einzelner Mensch aus dem Amazonasgebiet ein digitalisiertes Objekt aus seiner Region in einer Sammlung des globalen Nordens entdeckt, es beforschen und vielleicht Ansprüche stellen kann. Citizen Science, auch Demokratisierung von Sammlungen, verleiten zum Glauben, dass wir eine neue Masse suchten, eine andere Aufmerksamkeitsökonomie im digitalen Bereich.
Welche Fragen sollten sich die Institutionen im Kontext von Digitalisierung stellen?
Im Pergamonmuseum in Berlin steht eine Rekonstruktion des berühmten Ischtar-Tors aus babylonischer Zeit. Dass sich Menschen im heutigen Irak das digital anschauen können, führt erst mal zu nichts. Dahinter stehen ganz andere Fragen: Sollte das Tor überhaupt hier sein? Und falls ja, wer entscheidet darüber?
*The Other Nefertiti:
„The Other Nefertiti“, auch „Nofretete Hack“ genannt, ist 2016 mit Jan Nikolai Nelles entstanden. Das Projekt war eine Intervention im Neuen Museum Berlin. Wir haben die Ikone Nofretete ohne Wissen des Museums gescannt und den 3-Druck zunächst in Kairo ausgestellt und später in der Wüste vergraben – als Techno Heritage, das in Zukunft von jemandem gefunden werden kann. 3-D-Drucke sind das zeitgenössische Kulturerbe für die Kunst. Sie hebeln auch die Diskussion aus: Wem gehört eigentlich das digitale Objekt? Das ist zwar eine wiederkehrende und wichtige Frage. Aber häufig geht es dabei um die Besitzansprüche von Nationalstaaten und Regierungen. Uns hat es mehr interessiert, die Debatte auf philosophischer Ebene in Schwung zu bringen: Wem gehört diese Kunst? Digitale Reproduktion bedeutet die Möglichkeit millionenfacher Vervielfältigung. In der Folge des Projektes haben jetzt etliche Menschen die Nofretete in ihrem Wohnzimmer stehen. Auch solche, die nicht ins Neue Museum gehen können, zum Beispiel aufgrund ihres Passes.
Weitere Infos:
- Webseite Nora Al-Badri
- „Theater & Netz Vol. 7 – Entkolonialisierung des Geistes“ – Paneldiskussion bei der Böll-Stiftung mit Nora Al-Badri, Michael von zur Mühlen und Lionel Poutiaire Somé