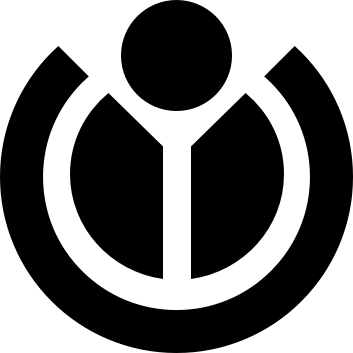N
Niemandsland
Eigentlich passt alles, was man über soziale Netzwerke und Verantwortung wissen muss, in einen einzigen Satz: Sei kein Arschloch! In der Praxis ist das jedoch, wie an diversen Beispielen zu sehen ist, komplizierter. Und die Wurzel vieler Übel steckt doch letztlich im Geschäftsmodell „pseudo-gratis gegen Daten“ im Netz. Versuch einer Anleitung zum Klarkommen im Niemandsland…
- Communitys
- Gemeinwohl
One size fits all? – Welche Verantwortung geht mit Reichweite auf Social Media einher?
Ein Essay.
Eigentlich passt alles, was man über soziale Netzwerke und Verantwortung wissen muss, in einen einzigen Satz: Sei kein Arschloch! Für den Fall, dass es jemand noch etwas konkreter mag: Schreibe nichts, was du nicht auch vor 50 Leuten auf einer Bühne mit deinen Eltern im Publikum sagen würdest. Erdacht habe ich diese weisen Worte allerdings nicht selbst, sondern sie stammen von Torsten Beeck und Ayla Kiran, meinen (ehemaligen) Vorgesetzten beim SPIEGEL.
Man darf jede Menge Dinge sagen. Aber man hat kein Recht darauf, dass einem niemand widerspricht
So einfach diese Regel klingt – wie diverse Beispiele zeigen, ist es in der Praxis doch komplizierter. Der Versuch einer Anleitung:
Mit der Verantwortung in den sozialen Netzwerken ist das so eine Sache. Das “Wird-man-ja-wohl-noch-sagen-Dürfen” ist mittlerweile zum geflügelten Wort geworden – dabei geht es meistens darum, legitime Kritik an den eigenen Äußerungen abschmettern zu wollen. Denn es ist nun einmal so: Man darf als Privatperson in sozialen Netzwerken (und auch im sogenannten Real Life) jede Menge Dinge sagen (sofern sie keinen Straftatbestand darstellen, was allerdings auch erst einmal von jemandem angezeigt und in der Folge von einem Gericht entschieden werden müsste). Aber man hat kein Recht darauf, dass einem niemand widerspricht. Und man hat auch nicht das Anrecht darauf, dass aus einer Äußerung keine Konsequenzen folgen. Dies gilt zum Glück für jeden Nutzenden – unabhängig von der Größe der Accounts.
Eigentlich, und das ist ja eine der schönen Sachen an diesen sozialen Netzwerken, gibt es kein groß und klein. Alle können ihre Meinung, ihre selbstgemalten Bilder oder sonstige Ergüsse ins Netz stellen – ein freies Internet ist da sehr demokratisch. Dieser Umstand hat in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass marginalisierte Gruppen, die sonst eher wenig Zugang zur Öffentlichkeit haben, über die sozialen Netzwerke mehr Aufmerksamkeit für ihre Anliegen gefunden haben. Die Beispiele sind zahlreich, Hashtags wie #MeToo (sexualisierte Gewalt), #MeTwo (Rassismuserfahrungen), #NotJustSad (Depressionen) sind vielleicht hierzulande die bekanntesten. Und es ist gut, dass diese Gruppen zusehends die Aufmerksamkeit bekommen, die ihnen zusteht. Auch wenn nicht alle alten Player damit umgehen können, dass sich plötzlich neue Stimmen erheben.
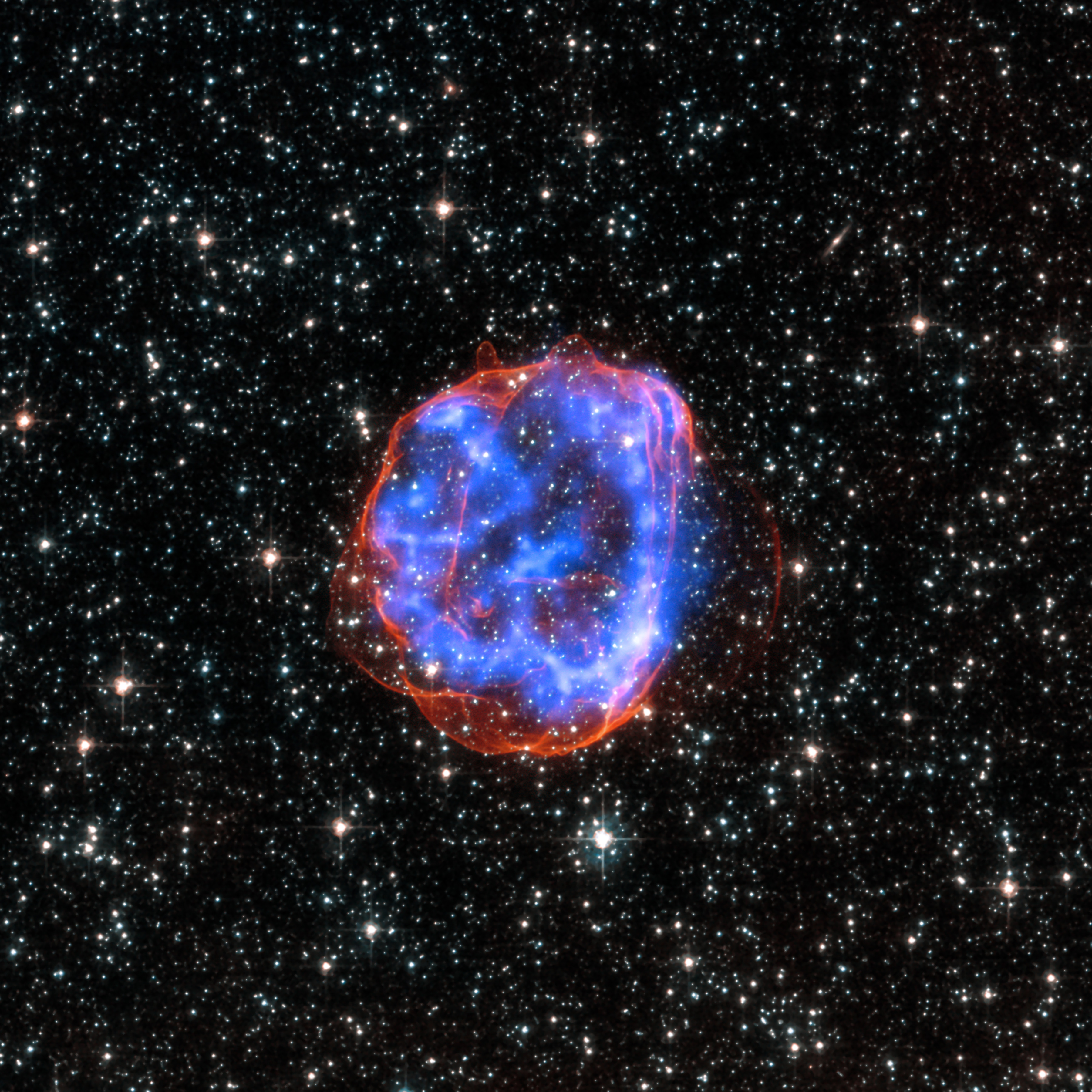
Vielen Nutzenden fehlt bis heute das Rüstzeug, seriöse von unseriösen Quellen zu unterscheiden
Warum müssen wir uns diese Gedanken überhaupt machen? Neben vielen positiven Errungenschaften haben die sozialen Netzwerke auch eine dunkle Seite – und die ist ziemlich mächtig. Ob Hass im Netz, Stalking oder auch das massenhafte Verbreiten von Fake News, die Probleme sind massiv und die Schäden für die Opfer immens. Im Netz „geborene” Verschwörungstheorien oder -ideologien wie QAnon* sind nur auf den ersten Blick lustig, auf den zweiten Blick sind sie zersetzend bis gefährlich – und vielen Nutzenden fehlt bis heute das Rüstzeug, seriöse von unseriösen Quellen zu unterscheiden. Wie auch, wenn selbst etablierte Medienhäuser immer wieder auf die Tricks von besonders gut organisierten Kleinstgruppen hereinfallen. Da wird beispielsweise in einer Telegram-Gruppe dazu aufgerufen, bei einem Fernsehsender anzurufen und sich über eine Sendung zu beschweren. Eine ungeschulte Redaktion, die sonst nie angerufen wird, erkennt möglicherweise nicht, dass es sich um eine konzertierte Aktion einer kleinen Gruppe handelt, und wähnt sich im Shitstorm.
Eine Verantwortung für unsere Accounts haben wir alle – egal, ob sie groß oder klein sind
Dies ist kein Aufruf dazu, legitime Kritik zu unterlassen und nicht mehr zum Telefon zu greifen, im Gegenteil. Wir machen alle Fehler und es ist gut, wenn wir darauf hingewiesen werden, damit wir sie korrigieren und aus ihnen lernen können. Doch es gibt keinen Grund, sich für richtige Entscheidungen zu entschuldigen oder zurückzurudern. Und hier gibt es natürlich schon einen Unterschied zwischen reichweitenstarken und reichweitenschwachen Accounts. Von reichweitenstarken Accounts, insbesondere bei Medienhäusern, sollte man erwarten können, dass sie professionell agieren und Menschen beschäftigen, die sich mit sozialen Netzwerken auskennen und ihre Funktionsweise verstehen. In der Praxis sind viele Social-Media-Teams aber unterbesetzt, und in den Redaktionen fehlt es an diversem Personal, welches in der Lage ist, zu entscheiden, was ein Fehler ist, wie man ihn korrigieren sollte, wie man im Jahr 2020 kommuniziert – und was aufgebauschte Empörung ist. Aber eine Verantwortung für unser Tun haben wir alle, egal, ob große oder kleine Accounts, egal, ob online oder offline.
Deswegen sollte man sich die folgenden drei Punkte zu Herzen nehmen:
1. Quellen checken und im Zweifelsfall nachrecherchieren.
2. Provozierenden Menschen keine Aufmerksamkeit schenken (kurz gesagt: Stop making stupid people famous).
3. Kontext liefern, wenn man etwas weiterverbreitet.
*QAnon
QAnon oder kurz Q nennt sich eine mutmaßlich US-amerikanische Person oder Gruppe, die seit 2017 Verschwörungstheorien mit rechtsextremem Hintergrund im Internet verbreitet. Das Pseudonym bezeichnet seitdem auch diese Verschwörungsthesen.
Weitere Infos:
Die Prophetie des Albus Dumbledore
Ein Interview.
Ein Internet ohne Beschränkungen – das war die Utopie der frühen Netz-Bewegung. Wieso geht es am Ende eben doch nicht ohne Regeln?
Die Idee war Freiheit. Nicht: Regellosigkeit. Das ist ein Unterschied. Freiheit bedeutet nicht, dass ich alles herausposaunen muss, was mir durch Kopf geht. Vor allem bedeutet es nicht, dass Äußerungen keine Konsequenzen haben dürften. Ich finde den Begriff „Niemandsland“ für das Netz deswegen auch nicht passend, „Neuland“ trifft es viel besser. Die Häme, die Angela Merkel entgegengeschlagen ist, als sie gesagt hat, das Internet sei für uns alle Neuland, halte ich für Besserwissertum und Arroganz. Ein bisschen mehr Demut und Einsicht, dass wir alle die Wahrheit nicht gepachtet haben, wäre angebrachter.
Sie selbst sind eine Pionierin des Netzes. Trotzdem sprechen Sie von Neuland?
Wir müssen immer noch ausprobieren, was funktioniert und was nicht, an welchen Stellen wir regulieren und eingreifen müssen. Als wir das Z-Netz aufgebaut haben, Ende der 80er-Jahre, war das Wort „Internet“ noch nicht wirklich bekannt. Aber es gab schon damals nicht nur technische Standards, wie Daten zwischen verschiedenen Mailbox-Servern ausgetauscht wurden, sondern auch eine grobe Übereinkunft, wie man miteinander klarkommen sollte. Es existierten also von Anfang an Regeln. Der Unterschied ist, dass wir in den frühen Zeiten mehr Handhabe hatten, sie selbst zu setzen. Indem wir beim Zerberus-Mailbox-Programm die Funktionen gestaltet haben, haben wir auch einen Kommunikationsrahmen errichtet – und an vielen Stellen dafür gesorgt, dass es friedlicher lief. Wir haben außerdem sichergestellt, dass die E-Mails in den persönlichen Postfächern verschlüsselt waren, mit dem Passwort der jeweiligen Teilnehmenden. Ebenfalls Regeln, in diesem Fall für den Schutz der privaten Kommunikation auf technischer Ebene.
„Das Bild der Datenkrake transportiert etwas Unheimliches, es beinhaltet aber auch den Respekt vor diesen ausgesprochen ästhetischen und intelligenten Tieren.“
Rena Tangens

Wie glückt so ein respektvolles Miteinander im Netz?
Natürlich gab es auch im Z-Netz heftige Auseinandersetzungen. Zum Beispiel im Brett Politik. Vor allem eine Person hat dort immer wieder rechte Ansichten, provokativ verpackt, gepostet. Die anderen haben sich daran abgearbeitet und versucht, diesen Menschen zu überzeugen. Der hatte aber natürlich gar kein Interesse an einem ernsthaften Diskurs, seine Absicht war ein Schaukampf für die Galerie. Wir wollten die Person aber auch nicht unkommentiert weiteragieren lassen. Also haben wir im Brett Politik einen Text verfasst und erklärt, dass wir nicht weiter auf ihn eingehen werden, weil wir uns die Themen nicht diktieren lassen wollen. Diesen Text haben alle im Politik-Brett Aktiven unterschrieben und er ist automatisch jede Woche einmal versendet worden, damit auch Neue ihn mitbekommen. Das hat ziemlich gut funktioniert.
Schon vor 20 Jahren haben Sie den Begriff „Datenkrake“ geprägt. Ist das Bild für Sie noch stimmig – und falls ja, wer sind heute die Kraken, vor denen wir uns am meisten in Acht nehmen müssen?
Für mich ist der Begriff noch treffend, weil er nicht so eindeutig abwertend ist wie „Datenverbrecher“ oder Ähnliches. Beschrieben wird damit der Versuch, an vielen Stellen etwas einzusammeln, das Bild transportiert etwas Unheimliches – ich weiß nicht genau, wann und wo der nächste Arm plötzlich hingreift –, es beinhaltet aber auch den Respekt vor diesen ausgesprochen ästhetischen und intelligenten Tieren. Auch Datenkraken sind oft faszinierend, trotzdem müssen wir ihnen an vielen Stellen Einhalt gebieten. Zum Beispiel dort, wo Firmen sich viele Rollen gleichzeitig anmaßen: unverzichtbare Infrastruktur für alle zu sein, außerdem Medium und Werbeagentur. Diese Machtkonzentration finde ich in einer Demokratie absolut inakzeptabel. Wir haben schon 2013 Google einen „BigBrotherAward“ verliehen – nach langer und gründlicher Recherche.
Was gab den Ausschlag dafür?
Google ist für mich eine der größten Datenkraken, nicht nur, weil der Konzern aus so vielen verschiedenen Quellen Daten sammelt und zusammenwirft, verarbeitet und kategorisiert. Google bestimmt auch, was relevant ist, allein schon durch die Gestaltung der Suchergebnisse. Das bedeutet ein unglaubliches Potenzial für Manipulation. Aber es geht ja noch weiter. Google hat sehr viel Macht auch über Technik. Die meisten Leute verändern wahrscheinlich nie ihren DNS-Server, der bei Google die Standard-Einstellung ist. Google hat außerdem das Betriebssystem Android, auf dem die meisten Smartphones mittlerweile laufen. Sie haben Chrome, den Browser, der die größte Verbreitung hat. Auch in den Medien mischt der Konzern mittlerweile an vielen Stellen mit. Weil zum Beispiel Zeitungen darunter leiden, dass Google und Facebook ihnen das Werbegeschäft weggeschnappt haben, sind sie nicht selten froh, wenn Google ihnen Projekte finanziert. Natürlich schreibt der Konzern keine redaktionellen Inhalte vor. Was da passiert, nennt man im PR-Bereich „Landschaftspflege“. Man macht sich Leute gewogen und schafft Abhängigkeiten. Niemand beißt die Hand, die einen füttert.
„Wir müssen im Netz ein grundsätzliches Problem angehen: das Geschäftsmodell „pseudo-gratis gegen Daten“. Das ist die Wurzel von sehr vielen Übeln.“
Rena Tangens
Seit der Gründung des Vereins Digitalcourage 1987 ist viel passiert. Trotzdem sprechen und streiten wir über ähnliche Themen wie damals: die Rolle des Datenschutzes, die Notwendigkeit sinnvoller Regulierung. Wo sehen Sie positive Entwicklungen?
Es gibt einen schönen Ausspruch von Albus Dumbledore aus dem vierten Harry-Potter-Band: ‚Die Zeit wird kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist.’ Das Wichtigste ist das Gefühl, etwas verändern zu können, sich nicht einreden zu lassen, es sei sowieso zu spät, an den Strukturen zu rütteln. Wir haben Zehntausende von Menschen für die „Freiheit statt Angst“-Demos in Berlin und anderen Städten auf die Straße gebracht, das waren die größten Demos seit den 80ern zu Volkszählungszeiten. Was aber die Aufgabe ist: Alternativen anzubieten. Dafür müssen wir aktiv sorgen. Wir brauchen einen europäischen Suchindex, damit es andere Suchmaschinen geben kann. Das ist eine große Aufgabe. Ich stelle mir ein öffentlich-rechtliches Modell vor, und zwar ein gesamteuropäisches. Das heißt eben nicht, dass wir eine europäische Suchmaschine brauchen. Aber einen Index, der Innovation und Wettbewerb wieder möglich macht.
Was bleibt die größte Baustelle?
Wir müssen im Netz ein grundsätzliches Problem angehen: das Geschäftsmodell „pseudo-gratis gegen Daten“. Das ist die Wurzel von sehr vielen Übeln. Als wir im Z-Netz die Mailboxen betrieben haben, waren Telefonkosten noch sehr hoch. Hat die Box mit einer anderen Stadt telefoniert, war das nicht mehr Ortstarif, sondern der Zähler tickerte. Deswegen haben Leute für die Mailbox bezahlt. So konnten wir gemeinschaftlich die Infrastruktur finanzieren – und zugleich fühlten sich auch alle mit verantwortlich. „Pseudo gratis“ meint eben auch, dass Algorithmen darauf angelegt sind, Leute möglichst lange auf der jeweiligen Plattform zu halten, was man bei Youtube besonders stark merkt. Und Aufmerksamkeit wird dadurch gebunden, dass immer kontroversere, radikalere Inhalte angezeigt werden. Ich wünsche mir eine Suchmaschine, die meinetwegen auch gerne kostenpflichtig ist, mir dafür aber nicht hinterherspioniert oder versucht, mich zu beeinflussen. Denn der Überwachungskapitalismus schadet der Demokratie.
Weitere Infos: