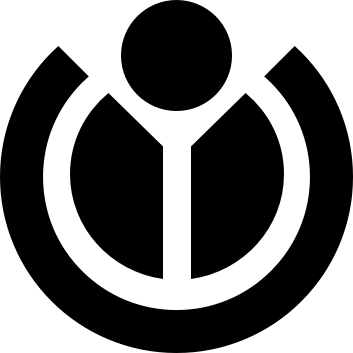Faire Verhältnisse: Wie kommen Urheber*innen und Nutzer*innen von Musik zu ihrem Recht?
Wie kommen Urheber*innen von Musik ebenso zu ihrem Recht wie die Nutzer*innen?
ANDREA GOETZKE: Jahrelang stand bei dieser Debatte vor allem das Urheberrecht im Fokus. So, wie sich die Marktstrukturen im Musikbereich gegenwärtig verändern, zeigt sich aber, dass die Probleme an anderer Stelle liegen. Große Plattformen wie Youtube oder Spotify, die mittlerweile die Bedingungen vorgeben, lizenzieren ja alles, da greift das Urheberrecht – und trotzdem verdienen die meisten Künstlerinnen und Künstler nicht viel Geld dabei. Es fehlt auch an Transparenz, nach welchen Schlüsseln diese Plattformen überhaupt ausschütten. Das ist ein strukturelles Problem, dem mit dem Hebel Urheberrecht nicht beizukommen ist.
MEIK MICHALKE: Die ständige Diskussion um das Urheberrecht ist in meinen Augen genauso eine Stellvertreterdebatte wie seinerzeit die Klage über illegale Downloads, die angeblich die Verkaufszahlen einbrechen lassen. Das lässt uns beim Thema „Wie funktioniert Kreativität im Internet?“ seit 20 Jahren auf der Stelle treten. Ich finde, die großen Gatekeeper, also Spotify & Co, sollten gar nicht das Ziel für aufstrebende Kreative sein. Wenn sowohl Künstlerinnen und Künstler als auch Fans zu ihrem Recht kommen sollen, muss man auf einem niedrigeren Level ansetzen: eine Community bilden und gemeinsam wachsen. Da öffnen sich Möglichkeiten, um nachhaltige Modelle – meinetwegen auch Geschäftsmodelle – aufzubauen. Die bieten vielleicht geringere Verdienstmöglichkeiten als der Massenmarkt, führen aber weiter als die Frage, welche EU-Richtlinie wir noch brauchen.
„Ich fände es interessant, das Urheberrecht mehr als Beziehung zwischen künstlerischen Arbeiten und ihren Produzent*innen zu denken, als zur Verwaltung einer Ressource, die nach bestimmten Rechten und Lizenzen nutzbar ist.“
Andrea Goetzke
GOETZKE: Eine Community mit den Fans zu bilden, das würde ich Kreativen auch empfehlen – das machen ja auch viele, zum Beispiel über bandcamp. Ich finde trotzdem, dass man die großen Strukturen politisch in den Blick nehmen und sich die Frage stellen muss: Wie soll dieses System funktionieren? Während der Pandemie hören alle zu Hause Musik über die Streaming-Plattformen, aber die Künstlerinnen und Künstlern, denen der Live-Bereich wegbricht, profitieren nicht davon.

MICHALKE: Was mir dazu einfällt: Ich habe zusammen mit Kolleginnen und Kollegen schon vor Jahren ein Konzept entwickelt, wie man die Geldströme fairer verteilen könnte. In den Playern, die man fürs Abspielen von Musik benutzt, findet dabei eine Erkennung statt, um was für einen Titel es sich handelt. Das haben wir über Audio-Fingerprinting gelöst. Man legt einen Account an, über den dann regelmäßig in einem bestimmten Abrechnungszeitraum gemeldet wird, welche Songs man gehört hat. Unter diesen Kreativen wird dann ein Betrag X verteilt. Das funktioniert natürlich auch nur, wenn es eine Community gibt, die bereit ist, dafür Geld auszugeben. Aber das System hätte den Vorteil, dass es im Grunde irrelevant ist, woher man seine Musik bezieht. Selbst, wenn sie illegal heruntergeladen wäre, würde man für das Abspielen Geld bekommen.
GOETZKE: Was ist daraus geworden?
MICHALKE: Wir haben das Konzept technisch bis zum Prototyp entwickelt, danach aber nicht mehr die Ressourcen, es an den Markt zu bringen. Der Code ist veröffentlicht, vielleicht sollte sich das noch mal jemand ansehen.
GOETZKE: Generell spielt ein Streaming-Modell natürlich Pop mehr in die Hände als experimenteller Musik. Man hat sich ja früher auch mal eine Platte gekauft und sie nur einmal gehört, weil man wissen wollte, was das ist – musste sich aber diesen Drone-Noise, als Beispiel, nicht jeden Tag geben. Was sperrig ist, hat einen Nachteil. Aber mich beschäftigt im Zusammenhang mit Urheberrecht und Lizenzen noch eine ganz andere Frage, die nichts mit Geld zu tun hat. In Musik steckt so viel an Beziehungen von einer Community, dass wir darüber nachdenken sollten: Wie lässt sich der Kontext eines Werks erhalten?
„In der Interaktion zwischen mir und dem Werk passiert das, was ich Kunst nenne.“
Meik Michalke
MICHALKE: An welchen Kontext denkst du dabei?
GOETZKE: Kürzlich hat zum Beispiel DeForrest Brown Jr., der sich viel mit afroamerikanischer Musikkultur beschäftigt, darüber gesprochen, wenn das Stück „Alabama“ von John Coltrane rein unter dem Gesichtspunkt der Entwicklung des Jazz diskutiert wird, werde es der Musik nicht gerecht. Geschrieben hat Coltrane es als Reaktion auf eine Reihe von Ku-Klux-Klan-Morden in Birmingham, Alabama. Ohne diesen Zusammenhang hört man das Lied ganz anders. Oder nehmen wir eine Person aus einer gewissen musikkulturellen Community, z. B. in Sao Paolo, die ein Stück produziert. Dann kommt ein Produzent aus New York, macht ein hippes Sample daraus – und selbst, wenn er der Künstlerin oder dem Künstler hundert Dollar dafür überweist, wäre es doch wichtig und interessant, diesen Kontext und diese Beziehung explizit darzustellen. Und man hat bei Spotify eben nicht mehr das Cover mit den Liner-Notes in der Hand. Ich fände es interessant, das Urheberrecht mehr als Beziehung zwischen künstlerischen Arbeiten und ihren Produzent*innen zu denken, als zur Verwaltung einer Ressource, die nach bestimmten Rechten und Lizenzen nutzbar ist.
MICHALKE: Ich sehe meinen eigenen Zugang zu Kreativität auch über Beziehungen – allerdings weniger über die Quelle, aus der ein Werk stammt. In der Interaktion zwischen mir und dem Werk passiert aus meiner Perspektive das, was ich Kunst nenne. Und das ist für mich die eigentlich spannende Ebene. Was macht es mit mir – und warum? Interpretiere ich ein Stück in zehn Jahren völlig anders? Aber um sich auf diese Beziehung wirklich einzulassen, braucht es Zeit. Der Akt, sich zu Hause hinzusetzen und ein Album wirklich von vorne bis hinten zu hören, macht einen ja heute zum Nerd. Wir sollten dahin kommen, Musik wieder hören zu lernen. Solche Prozesse zu ermöglichen, darauf auch wieder Märkte aufzubauen, ist meine Vision. Die Frage lautet: Geht das mit dem klassischen Urheberrecht oder wählt man eine Creative-Commons-Lizenz – die ist für die Auseinandersetzung mit dem Werk letztlich irrelevant. Hauptsache, man findet einen Zugang dazu.