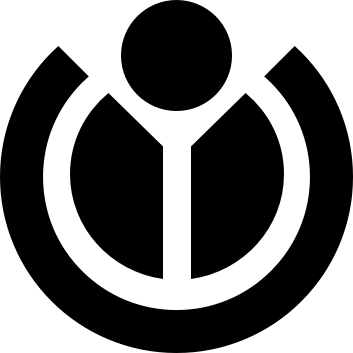Ziel: Lebenslanges Lernen – Kann Open Education bewährte und neue Lernorte verbinden?
Jana Haase und André Hermes im Gespräch
Wie sollten Lernräume der Zukunft aussehen und gestaltet werden?
JANA HAASE: Schulgebäude haben wir viele – in gewisser Hinsicht sogar zu viele. Von viereckigen Räumen mit Bankreihen, die starr ausgerichtet sind, Struktur vorgeben und eingrenzen, brauchen wir meiner Ansicht nach nicht noch mehr. Was fehlt, ist Offenheit. Die Möglichkeit, Räume zu verlassen, zu erweitern, miteinander zu interagieren.
ANDRÉ HERMES: Schulen wurden ja häufig in Epochen gebaut, die auf eine ganz spezifische Art des Lehrens – gar nicht unbedingt des Lernens – ausgerichtet waren. Auf ein Beibringen, In-die-Köpfe-Reindrücken. Mit offenen Strukturen könnte man sowohl den klassischen Lehrbetrieb als auch Open Spaces an der Schule ermöglichen. Häufig sind das Selbstlern-Zentren, wo Steckdose und WLAN genügen. An unserer Schule gibt es einen Baukeller, in dem die Schülerinnen und Schüler Roboter konstruieren und programmieren können. Auch das ist ein Lernort.
Welche Rolle könnten dritte Lernorte spielen – gerade im Hinblick auf integrative Lehre und mehr Chancengerechtigkeit?
HAASE: „Dritte Orte“ ist ja ein Begriff aus der Soziologie. Der erste Ort ist das Zuhause, der zweite die Arbeit – aber dazwischen muss es noch andere Zusammenhänge geben, in denen ich mich austauschen kann: das Caféhaus, der Marktplatz – oder eben die öffentlichen Bibliotheken. Im schulischen Kontext könnten das Orte sein, wo kein Unterricht und keine Betreuung stattfinden, sondern wo die Schülerinnen und Schüler frei agieren können – mit Bastelmaterialien, Büchern oder sonstigen Unterhaltungs- und Informationsmitteln.

HERMES: Weitergedacht auf außerschulisches Lernen, können das auch Museen, botanische Gärten oder Zoos sein, selbst der McDonald’s nebenan, wenn es nur um ein stabiles WLAN geht – ebenso Maker Spaces, also offene Werkstätten oder Vereine. Die Chance für Integration und Chancengerechtigkeit liegt in der Offenheit dieser Orte. Sie müssen zugänglich für alle sein. Was wiederum nicht bedeutet, dass sie von allen Bevölkerungsgruppen gleich genutzt werden. Ein Science-Center besuchen abseits der Schule vor allem Menschen mit höherem Bildungsgrad. Offenheit ist nicht alles – aber sie ist die Grundvoraussetzung für Chancengleichheit.
„Youtube ist nicht nur der größte Wissensvermittler, sondern auch der größte Fake-Verbreiter. Geordnete Strukturen jenseits davon wären wünschenswert.“
André Hermes
HAASE: Inwiefern ist Offenheit nicht alles?
HERMES: Wenn eine Bibliothek beispielsweise mit Schulen kooperieren möchte, aber nur die Gymnasien im Blick hat, werden große Gruppen ausgeschlossen, die dort auch sehr viel lernen könnten. Entsprechend breit sollten die Angebote aufgestellt sein.
HAASE: Der Deutsche Bibliotheksverband unterhält zusammen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung seit einigen Jahren das Förderprogramm „Kultur macht stark. Total digital!“, das gute Angebote macht. Sie brauchen natürlich sehr viel Begleitung. Schön wäre es, wenn daraus noch mehr offene Räume erwachsen könnten, die von Jugendlichen als Orte für lebenslanges Lernen wahrgenommen werden.
Auf dem „Forum Open Education“ wurde zuletzt über Medienkompetenzzentren diskutiert. Könnte man in diesem Zusammenhang auch die Rolle von Schulen und Bibliotheken überdenken?
HERMES: Medienbildung muss Bestandteil der institutionellen Schulbildung sein. Aber natürlich sind die Schulen hier unterschiedlich stark aufgestellt. Sicherlich haben einige Kompetenzzentren einen Schwerpunkt, den Unterricht oder Informatikkurse nicht abbilden können. Einen 3-D-Drucker besitzen die wenigsten Schulen. Zudem sind sie meistens auf ein oder zwei Betriebssysteme ausgerichtet, mit Apple-Geräten oder Windows-Rechnern, kennen aber die Welt der linux-basierten offenen Infrastrukturen gar nicht. Auch da wäre es denkbar, den Horizont zu weiten.
HAASE: Viele Stadtbibliotheken haben ja schon so etwas wie Maker Spaces eingerichtet – als öffentliche, frei zugängliche Experimentierwerkstätten. Aber es ist immer sinnvoll, sich für bestimmte Reihen oder Workshops Expertinnen und Experten von außen zu holen. Ich weiß nicht, ob man Medienkompetenzzentren als neue Institutionen schaffen muss – oder ob die vorhandenen Institutionen nicht gemeinsam Medienkompetenzzentren bilden könnten.
Welche weiteren Institutionen und Projekte könnten als dritte Lernorte noch zu einer digitalen Bildungslandschaft beitragen?
HERMES: Da denke ich besonders an den großen Bereich der Bildungslandschaft im Internet. Das reicht von Anbietern im Bereich Medien und Kommunikation, die ein großes Portfolio haben, um lebenslanges Lernen zu ermöglichen. Bis hin zu Plattformen wie Youtube, die bei unseren älteren Schülerinnen und Schülern die erste Anlaufstelle sind, wenn es um informelles Lernen geht. Wenn ich wissen will, wie das Flusensieb meiner Waschmaschine ausgewechselt wird, schaue ich dort nach. Youtube ist aber nicht nur der größte Wissensvermittler, sondern auch der größte Fake-Verbreiter. Geordnete Strukturen jenseits davon wären wünschenswert.
„Wenn ich Quellen benenne, zeige ich den Schülerinnen und Schülern, dass ich genau wie sie ein lernender Mensch bin.“
Jana Haase
HAASE: Das könnten auch Bibliotheken unterstützen, zum Beispiel mit Link-Listen, die gepflegt werden. Die Frage ist nur: Gehen die Menschen sofort zu Youtube oder orientieren sie sich erst auf der Seite der Bibliothek, um zu schauen, was vorsortiert wurde? Es bräuchte wohl noch viel Arbeit, um hier an Attraktivität zu gewinnen.
HERMES: Häufig ist es so, dass im Unterricht solche Artefakte genutzt werden – aber eben von Lehrern kuratiert, das heißt, die Schülerinnen und Schüler kennen die Quelle gar nicht. Wenn ich jungen Menschen vermitteln will, dass sie auch nach der Schule handlungsorientiert an der Gesellschaft teilhaben können, muss ich ihnen auch zeigen, wie man zum Beispiel mit frei lizenzierten Materialien umgeht, welche Angaben dann notwendig sind. Das gilt natürlich auch für die Materialien, die Lehrende reingeben – schon um Transparenz zu schaffen.
HAASE: Wenn man das konsequent macht, transportiert es auch eine andere Kultur und ermöglicht ein Lernen auf Augenhöhe. Wenn ich Quellen benenne, öffne ich den Schülerinnen und Schülern nicht nur den Weg zu ihnen, sondern zeige auch, dass ich genau wie sie ein lernender Mensch bin.